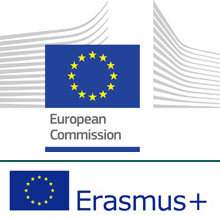Schweizer Banken sind – wie ihre Konkurrenten in der Europäischen Union – immer wieder in Geldwäsche verstrickt. Beispielhaft sind aus jüngster Zeit zu nennen: Ein Pariser Gericht hat die größte Bank der Schweiz, die UBS, im Februar 2019 zu einer Rekordbuße in Höhe von 3,7 Milliarden Euro sowie 800 Millionen Euro Schadensersatz wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung zugunsten französischer Kunden verurteilt. Die Sachverhalte, die den Verdachtsmeldungen in der Schweiz zugrunde liegen, haben allerdings in der Mehrzahl der Fälle einen internationalen Bezug und stehen bemerkenswerterweise oft im Zusammenhang mit Korruption: In dem Skandal um den malaysischen Staatsfonds 1MDB waren unter anderen die UBS, die Privatbank BSI, die Falcon Private Bank und die Privatbank Coutts involviert. Bei diesem Fonds wurden über 7,5 Mrd. US-Dollar in private Taschen abgezweigt. Darüber hinaus waren Schweizer Banken in den Korruptionsfall um den brasilianischen Energiekonzern Petrobras sowie den brasilianischen Baukonzern Odebrecht verstrickt, wobei es ebenfalls um korruptive bzw. unterschlagene Gelder in Milliardenhöhe ging. Bei der Credit Suisse, der zweitgrößten Schweizer Bank, hat deren Verwicklung im Korruptionsfall um den internationalen Fußballverband FIFA Wellen geschlagen.
Was macht den Finanzplatz Schweiz so anfällig für Geldwäsche?
Die Ursache hierfür ist im spezifischen Geschäftsmodell der Schweizer Banken zu suchen, die sich im internationalen Wettbewerb als Drehscheibe der privaten Vermögensverwaltung behaupten. Es gibt viele Gründe dafür, dass Kunden weltweit die Schweiz als Anlageland bevorzugen. Das Schweizer Bankgeheimnis gehört dazu, obwohl dieses durch den steuerlichen Informationsaustausch nach den Standards der OECD, die die die Schweiz akzeptieren musste, löchriger geworden ist.
Das Private Banking mit betuchten Kunden und das Wealth Management, also die Verwaltung privater Vermögen, ist jedoch nach wie vor das Asset des Finanzplatzes Schweiz. Es bezeichnet die umfassende finanzielle Betreuung von Privatpersonen und deren Vermögen. Banken und Vermögensverwalter in der Schweiz verwalteten 2018 insgesamt 3,7 Billionen Schweizer Franken an Privatvermögen. 62 Prozent davon sind Kunden zuzuordnen, die nicht ihren (Wohn-)Sitz im Ausland haben. Der Finanzplatz Schweiz beherrscht im Private Banking ca. ein Viertel bis ein Drittel des Weltmarktes. Vermögensverwaltung ist damit eine der bedeutendsten Export-Dienstleistungen der Schweiz. Die grenzüberschreitend verwalteten Privatvermögen haben von 2013 bis 2018 um 300 Mrd. Schweizer Franken zugenommen.
Die Vermögensverwaltung weist eine immense personelle Infrastruktur auf. Zu diesem Netzwerk gehören nicht nur Schweizer Banken, sondern auch Treuhänder und Anwälte. Es versteht sich von selbst, dass diese Finanzdienstleistung auch für Kriminelle attraktiv ist. In der letzten Phase der Geldwäsche, der Investment-Phase, werden die illegal generierten Gelder, nachdem sie mehrfach über Strohmänner und Offshore-Gesellschaften hin- und hergeschoben worden sind, in Finanzprodukten und in der Realwirtschaft platziert. Die Vermögensverwaltung ist dabei das Eingangstor zur Finanz-Unterwelt, zur Schattenwirtschaft.
Das Vermögensverwaltungsgeschäft der Schweizer Banken hat sich im zweiten Jahrzehnt dieses Jahrhunderts gewandelt. Eine Hauptaktivität der meisten Schweizer Banken war bis dahin die Betreuung ausländischer Kunden von der Schweiz aus. Adressaten waren vornehmlich Kunden in den USA und in europäischen Staaten, wobei Zweigstellen und Tochtergesellschaften Schweizer Banken in diesen Ländern, insbesondere in Deutschland, als Scharnier dienten. Bei den Vermögen dieser Mandanten hatte es sich vielfach um Schwarzgeld gehandelt. In Deutschland hatte u. a. der Nordrhein-Westfälische Finanzminister Speichermedien aufgekauft, welche gestohlene Datensätze von Bankkunden enthielten (Steuersünder-CDs). Nach Auswertung dieser Datenträger wurde eine Vielzahl von Steuerstrafverfahren gegen Kunden in Deutschland und Schweizer Banken in Deutschland eingeleitet. Kunden mit Schwarzgeldkonten in der Schweiz hielten es für opportun, sich selbst anzuzeigen, um einen Strafnachlass zu erlangen. Hinzu kam, dass die Schweiz in dem im Jahr 2008 ausgebrochenen Steuerstreit mit den USA den Kürzeren gezogen hatte. Anfang 2009 gab die US-Steuerbehörde IRS ein Amnestieprogramm bekannt. Um ihre Gelder zu legalisieren und einer Strafverfolgung zu entgehen, mussten reuige US-Kunden unter anderem Banken und Berater nennen, die ihnen geholfen hatten, ihr Geld am Fiskus vorbeizuschleusen. Mitarbeiter Schweizer Banken in den USA wurden verhaftet und zu Gefängnisstrafen verurteilt. Das „Geschäftsmodell“ Schweizer Banken erlitt damit Schiffbruch. Grenzüberschreitende Geschäftsbeziehungen mit US-Kunden und Kunden in der Europäischen Union mussten deutlich abgebaut werden. In der internationalen Öffentlichkeit gerierte sich dabei die Schweiz zur Wiedererlangung der verspielten Reputation als reuiger Sünder, der zukünftig einer „Weißgeldstrategie“ folgen und deshalb nur Anlagegelder entgegennehmen wollte, deren legale Herkunft sauber von den Banken abgeprüft und unter Berücksichtigung des nationalen Steuerrechts, dem der Kunde unterworfen ist, unbedenklich ist.
Eine Weißgeldstrategie sieht anders aus
Tatsächlich gaben Schweizer Banken das alte Geschäftsmodell jedoch nicht völlig auf, sondern strickten dieses lediglich um. Sie konzentrierten sich verstärkt auf die Superreichen in den neuen Märkten, die in der Regel von laxeren Finanzmarktaufsichts-, Steuer- und Ermittlungsbehörden kontrolliert werden. Viele Gelder von dubiosen Kunden wurden in den „Emerging Markets“ in Asien und Lateinamerika von Kundenbetreuern Schweizer Banken vor Ort akquiriert, wobei die von der Bank entgegengenommen und damit gewaschenen Gelder gar nicht mehr auf Konten und Depots in der Schweiz fließen mussten, sondern in Drittstaaten platziert wurden.
Die „high performer“ unter den Kundenbetreuern kassierten in diesem neuen, höchst profitablen Geschäftszweig nicht nur riesige Boni. Was die Abklärung des renditebringenden Kunden und ihrer Vermögen im Rahmen der Aufnahme einer Geschäftsbeziehung anbelangt, unterlagen diese durch die Vorstände Schweizer Banken und ihrer „compliance officers“ der internen Anti-Geldwäscheabteilungen kaum Kontrollen. Während die internen Anforderungen an die Kundensorgfaltspflichten, die die Bankmitarbeiter zu erfüllen haben, immer strenger geworden sind und die Zahl der Verdachtsmeldungen Schweizer Banken – ebenso wie bei den EU-Banken – deutlich in die Höhe geschossen ist, hatten die besten Pferde im Stall der Kundenbetreuer bei ihrer Kundenanwerbung freie Hand. Verdachtsmeldungen an die staatlichen Stellen hat es für diese Klientel kaum gegeben. Dies hat – insbesondere im Fall der Privatbank Julius Bär – die Schweizerische Bankenaufsicht FINMA mit strengeren Anforderungen an die „know-your-customer-policy“ inzwischen auf den Plan gerufen.
Bei diesem Messen mit zweierlei Maß handelt sich aber nicht nur um ein schweizerisches Phänomen. Ähnliche Defizite sind auch bei EU-Banken bekannt geworden. Welche Bank, die schließlich gewinnorientiert arbeitet, meldet ihre „guten“ Kunden, die hohe Erträge generieren, bei Auffälligkeiten mit leichter Hand den staatlichen Verdachtsmeldestellen und setzt damit die Geschäftsbeziehung auf´s Spiel? Selbst wenn damit das Risiko verbunden ist, dass beim Bekanntwerden eines solchen Sachverhalts auf die Bank ein Reputationsproblem zurollt und diese mit operationellen Risiken in der Bilanz rechnen muss, wird diese Trennung vom „guten Kunden“ eher die Ausnahme als die Regel sein.
Ein weitreichendes „Whistleblowing-System“ muss das Verdachtsmeldewesen flankieren
Eine wirksame Strategie gegen Geldwäsche setzt nach Ansicht von mafianeindanke voraus, den bisherigen Ansatz gegen Geldwäsche, wie er europaweit und international zum Standard geworden ist, zu überdenken. Selbstverständlich macht es Sinn, dass Aufsichtsbehörden weiterhin die strikte Einhaltung der Verdachtsmeldepflicht und der Kundensorgfaltspflichten bei Banken und anderen Verpflichteten einfordern. Die den Aufsichtsbehörden zur Verfügung stehenden Prüfungsmechanismen, selbst wenn die Zahl der Vor-Ort-Prüfungen signifikant gesteigert würde, leisten es jedoch nicht, gerade die dargestellten Fälle der Geldwäsche aus schweren Straftaten lückenlos aufzuspüren. Banken können es also auf die Nichtbeachtung des Geldwäschegesetzes ankommen lassen, weil diese meist durch die Maschen der Aufsichts- und der Ermittlungsbehörden rutschen.
Mehr Kontrolldichte könnte dadurch hergestellt werden, dass das bestehende Verdachtsmeldesystem und dessen Einhaltung durch ein funktionierendes Whistleblower-System flankiert wird. Whistleblower sind Personen, die Rechtsverstöße oder anderes Fehlverhalten offenlegen oder melden. Es gibt gesellschaftliche und wirtschaftliche Bereiche, wo Whistleblower unverzichtbar sind. Dazu gehören Geldwäsche oder Korruption. Die Schaffung von Whistleblowersystemen gehört zu den Pflichten der Aufsichtsbehörden im deutschen Geldwäschegesetz. In der Praxis haben diese nur allgemein formulierten Pflichten jedoch nur einen symbolischen Charakter. Bisher sind diese Systeme nicht operabel. Sie schützen den Whistleblower nicht wirksam, wenn er sich nach außen wendet. Kein Wunder also, dass viele Mitarbeiter von Banken und sonstigen Unternehmen, die auf Missstände hinweisen wollen, anonym bleiben wollen oder gar ihre Kenntnisse für sich behalten.
In der Schweiz ist die Situation noch unbefriedigender. Bisher hat der Schweizer Bundesrat jede Initiative für gesetzliche Regelungen in diesem Bereich abgelehnt. Whistleblower riskieren deshalb die Kündigung ihres Arbeitsverhältnisses, gesellschaftliche Ächtung und manchmal sogar eine Strafverfolgung.
Im Oktober 2019 hat die Europäische Union eine Richtlinie zum Schutz von Personen verabschiedet, die in beruflichem Zusammenhang Verstöße gegen geltendes EU-Recht melden. Der deutsche Gesetzgeber muss diese Richtlinie innerhalb von zwei Jahren umsetzen. Die Zivilgesellschaft sollte sich frühzeitig in die Umsetzung der Richtlinie einmischen. Mafianeindanke wird dies tun.